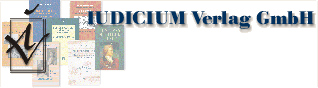Dass Wasserleichen im Volksglauben der
japanischen Fischer als Glücksbringer und als Erscheinungsform des Gottes
Ebisu verehrt werden, scheint zunächst widersprüchlich. Leichen gelten im
japanischen Volksglauben als hochgradig unrein, und normalerweise soll ein
komplexes System aus Tabus und Meidungsvorschriften verhindern, dass
Unreinheit, das kegare, an Bord eines Fischerboots gelangt und dort
den Fangerfolg und die Sicherheit der Besatzung gefährdet. Die vorliegende
Arbeit versucht, den Brauch der Wasserleichenverehrung in dieses System
einzuordnen und seine Beziehung zu den verschiedenen Elementen des
Volksglaubens der japanischen Fischer aufzuzeigen.
INHALT
0. Einleitung
Allgemeines · Forschungsfragen · Aufbau und Vorgehensweise · Literatur
1. Das kegare
Der Begriff des kegare in der japanischen Volkskunde · Elemente des
kegare · Eigenschaften des kegare und ihre unterschiedliche
Ausformung · Der rituelle Umgang mit dem kegare · Konkrete Formen des
kegare · Sonderformen des kegare · Rituelle Umwandlung des
kegare durch Anheftung und Austreibung · Der Buddhismus und das
kegare
2. Ebisu
Der Name Ebisus · Grenzräume und die andere Welt · Fremde und Besucher · Die
Ursprünge des Ebisuglaubens · Ebisu und seine Funktionen · Objekte der
Ebisu-Verehrung · Ebisus Charakter und Eigenschaften
3. Die Glaubenswelt der
japanischen Fischer
Das gefährliche Leben der Fischer · Die Fischer und das kegare ·
Schiffsgeister · Der gezielte Tabubruch und die Kraft des kegare
4. Wasserleichen und Ebisu
Regionale Unterschiede · Die Häufigkeit von Wasserleichenfunden · Das
korrekte Aufsammeln · Der korrekte Transport · Die korrekte Entsorgung ·
Auswirkungen
5. Interpretation
Warum werden Wasserleichen verehrt? · Wie funktioniert das System von
Reinheit und Unreinheit bei den japanischen Fischern, wie der gezielte
Tabubruch? · Wie passt die Verehrung der Wasserleichen in das System von
Reinheit und Unreinheit bei den japanischen Fischern?
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
Christian Göhlert, geb. 1982, studierte
Japanologie, Sinologie und Religionswissenschaft an der
Ludwig-Maximilians-Universität, wo er seit 2008 auch an seiner Dissertation
arbeitet. Seit 2010 forscht er an der Seijo University in Tokyo.
|